Unsere Veranstaltungen

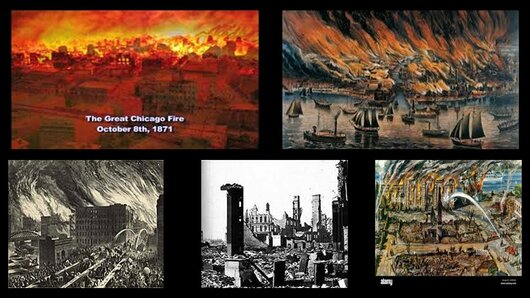
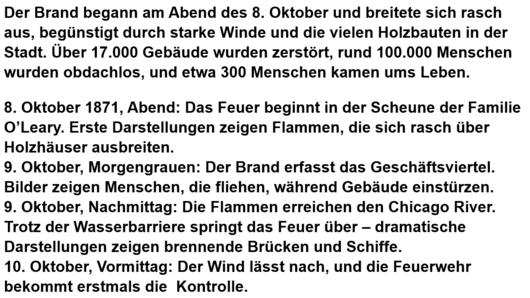
Dwight Lyman Moody
Als der Erweckungsprediger Dwight L. Moody
am 8. September 1871 in Chicago anfing zu predigen,
machte er am ersten Abend einen folgenschweren Fehler.
Er forderte seine Zuhörer auf, sich über die Frage
„Was fange ich mit Jesus an? “ Gedanken zu machen.
Er beendete seine Predigt mit folgenden Worten:
„Ich wünsche, dass ihr das Gesagte mit nach Hause nehmt,
und noch einmal darüber nachdenkt,
nächste Woche werden wir entscheiden,
was wir mit Jesus von Nazareth tun werden.“
Doch am 10.September 1871 lag Chicago in Schutt und Asche.
Ein vernichtendes Großfeuer wütete vom 8. bis 10. September
und zerstörte große Teile der Innenstadt.
Diese schreckliche Katastrophe von Chicago
sollte in die Geschichtsbücher eingehen.
Viele der Hörer Moodys starben bei dieser Katastrophe.
Er hatte bei der besagten Predigt
den Zuhörern nicht deutlich vor Augen geführt,
dass sie Jesus schon an dem Abend des 8.September 1871
als Retter hätten annehmen müssen.
ES IST NIE ZU FRÜH FÜR JESUS, DOCH ES GIBT EIN ZUSPÄT

Wie konnte das passieren?
Eine theologisch-historische Betrachtung deutscher Geschichte im Licht biblischer Linien
1. Einleitung: Die Frage nach dem „Wie“ und das biblische Denken
Die Frage „Wie konnte ein kulturell hochentwickeltes Land, geprägt von Philosophie, Musik, Wissenschaft, der Reformation und christlicher Tradition, in eine solche Finsternis geraten?
Und das in einem atemberaubendem Tempo.
Ab 1920 aus dem nichts bis zur Machtergreifung Hitlers 1933 bis zur „Blüte des NS-Regimes 1939“ bis zur totalen Finsternis 1945.
Mit der Vernichtung des alten Deutschlands, Neues Entstand, und das aus Gnade!
Das ist nicht nur eine rein historische, sondern vor allem eine zutiefst geistliche Fragestellung. Die Bibel betrachtet Geschichte als einen Raum, in dem Gott handelt, Menschen Entscheidungen treffen und unsichtbare Mächte wirken.
Kierkegaard bringt dies treffend auf den Punkt: „Verstehen kann man das Leben rückwärts; leben muss man es vorwärts.“ Erst im Rückblick erkennen wir Gottes Wirken und menschliche Irrwege. Auch die Bibel arbeitet auf diese Weise – sie deutet im Rückblick, warnt und schenkt Hoffnung für den Ausblick.
Der Griff nach den Medien, den Kirchen und der Jugend war das dämonische Konzept.
Gleichschaltung aller Bereiche der Gesellschaft das Programm.
Wer die Geistlichkeit beherrscht, hat leichteres Spiel. Und das protestantische Christentum war empfänglich.
2.Der Krieg war verloren und Deutschland nach 1918: Ein geistlich verletztes Land
2.1 Gesellschaftliche Erschütterung
Der Zusammenbruch des Kaiserreichs führte zu einer tiefgreifenden Identitätskrise im protestantischen Bürgertum. Wirtschaftliche Not, Inflation und politische Instabilität prägten das Land. Mit dem Verlust des alten Selbstverständnisses, das sich als „Gottes auserwähltes Kulturvolk“ sah, entstand eine kollektive Verunsicherung.
2.2 Geistliche Dimension
Die Kirchen hatten sich an Macht, Staat und kulturelle Vormachtstellung gewöhnt. Der Verlust des Kaisers als „Schutzherr der Protestanten“ wurde als geistlicher Einschnitt empfunden.
In dieser Unsicherheit wuchs die Sehnsucht nach Ordnung, Stärke und nationaler Wiedergeburt.
Theologische Schärfung
Bereits im Alten Testament begegnen wir Parallelen: Das Volk Israel verlangte in 1. Samuel 8 einen König „wie die anderen Völker“.
In Hosea 8,4 heißt es kritisch: „Sie haben Könige eingesetzt, aber nicht durch mich.“
Und Jesus selbst warnt vor „falschen Christussen“ (Matthäus 24,24).
3. Der geistliche Angriff: Ideologie als Ersatzreligion
3.1 Der Einstieg der völkischen Bewegung
Der „Bund für deutsche Kirche“ unter Kurd Niedlich öffnete die Tür für eine germanisierte Religion. Ziel war es, das Christentum zu entjudaisieren und biblische Inhalte durch mythische, „Blut-und-Boden“-Ideologie zu ersetzen.
Man versuchte sogar, Jesus zu „instrumentalisieren“ , als arischer Held, der sich gegen das Judentum stellt und dafür den Tod riskiert.– ein theologischer Skandal und eine geistliche Verkehrung.
Theologische Schärfung
Der Satan bietet Jesus Macht ohne Kreuz (Matthäus 4). Ebenso bot die völkische Bewegung ein Christentum ohne Israel, ohne Demut, ohne Gericht und ohne Gnade an.
3.2 Die Gleichschaltung der Kirche
1933 gewannen die „Deutschen Christen“ Macht in den Landeskirchen. Das Führerprinzip wurde eingeführt, das Reichsbischofsamt (Ludwig Müller) errichtet und massive staatliche Einflussnahme (August Jäger) durchgesetzt. Demokratische Strukturen wurden zerschlagen.
Historische Präzisierung
Die Gleichschaltung betraf alle gesellschaftlichen Bereiche und war auch kein innerkirchlicher Prozess, sondern ein staatlicher Gewaltakt.
Viele Kirchenleitungen machten mit – aus Angst, Opportunismus oder sogar echter Begeisterung.
Theologische Schärfung
Philipper 3,20 erinnert: „Unser Bürgerrecht ist im Himmel.“ Und Jesus sagt: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ (Johannes 18,36)
4. Der Kirchenkampf: Anpassung, Verführung und wenige Gerechte
4.1 Die Mehrheit: Zustimmung oder Schweigen
Viele Pfarrer und Kirchenmitglieder begrüßten den „nationalen Aufbruch“. Antisemitische Gedanken waren bereits vorher verbreitet. Die Kirche hoffte auf moralische Erneuerung und übersah dabei die dämonische Natur des Regimes.
4.2 Die Minderheit: Bekennende Kirche und Einzelne
Einzelne wie Bonhoeffer, Niemöller, Elisabeth Schmitz, Graf von Galen oder Lichtenberg standen als „Gerechte“ auf – wie Abraham für Sodom (Gen 18). Sie waren zwar wenige, verhinderten aber das völlige Untergehen der Kirche.
Theologische Schärfung
Gott rettet um der wenigen Gerechten willen (Noah, Abraham, Daniel). Die Kirche lebt nicht aus der Mehrheit, sondern aus ihrer Treue.
5. Der Zusammenbruch und das Schuldbekenntnis
5.1 1945: Ende, Gericht, Gnade
Der Zweite Weltkrieg forderte 70 Millionen Tote und 6Millionen systematisch ermordeten Juden– ein apokalyptisches Szenario.
Deutschland hätte historisch „verschwinden“ können, doch stattdessen folgten Wiederaufbau, Hilfe der Alliierten und die Westintegration.
Theologische Deutung
Die Güte des Herrn hat kein Ende.“ (Klagelieder 3,22) und „Gottes Güte leitet dich zur Umkehr.“ (Römer 2,4) deuten an, dass Gnade und Gericht sich in der Geschichte begegnen.
5.2 Das Stuttgarter Schuldbekenntnis (1945)
Mit dem Stuttgarter Schuldbekenntnis machte die EKD erstmals offiziell eigene Schuld öffentlich. Damit begann die Aufarbeitung des kirchlichen Antisemitismus – spät, aber mit echter Einsicht.
6. Israel und die Rückkehr: Prophetie und Geschichte
6.1 Biblische Linien
Jeremia 29 beschreibt das Exil nicht nur als Strafe, sondern auch als Auftrag.
Die Rückkehr nach 70 Jahren – aber nur ein Rest kehrt zurück – ist ein biblisches Muster: Zerstreuung, Bewahrung und Rückkehr.
6.2 Neuzeitliche Entwicklung
Herzl und der politische Zionismus, die Shoah als Katalysator und die Gründung Israels 1948 setzen diese biblischen Linien fort.
Bibelstellen wie Jesaja 11,12 (Sammlung der Zerstreuten) und Hesekiel 36–37 (Rückkehr und geistliche Erneuerung) bieten einen Deutungsrahmen.
Es lässt sich theologisch nicht beweisen, dass Gott Herzls Gedanken direkt „geschürt“ hat, doch biblisch ist es anschlussfähig: Gott wirkt durch Menschen, auch durch säkulare.
7. Gegenwart: Parallelen, Warnungen, geistliche Diagnose
7.1 Gesellschaftliche Parallelen
In der Gegenwart zeigen sich erneut Muster wie Entsolidarisierung, Polarisierung, Identitätskrisen, Vertrauensverlust in Institutionen und eine Fragmentierung der Gesellschaft.
7.2 Kirchliche Parallelen
Die EKD heute verliert zunehmend geistliche Autorität, passt sich dem Zeitgeist an.
Anbiederung an den Islam, bei Selbstaufgabe der eigenen Glaubensidentität.
Sprachlosigkeit bei Christenverfolgung und gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen.
So gilt auch heute,
denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen.
Epheser 6,12
7.3 Theologische Schärfung
Psalm 12 beschreibt treffend die Lage: „Die Frommen sind dahin“ – der Verlust geistlicher Orientierung.
„Allein den Betern kann es noch gelingen“ – geistliche Erneuerung beginnt im Verborgenen.
8. Schluss: Die Verantwortung der Gegenwart
Geschichte wiederholt sich nicht, aber bestimmte Muster kehren zurück. Die Bibel mahnt zur Wachsamkeit, nicht zur Angst.
Die Kirche ist aufgerufen, aus ihrer Geschichte zu lernen: Christus statt Ideologie, Wahrheit statt Anpassung, Mut statt Schweigen und Gebet statt Resignation sollen ihr Handeln bestimmen.
Das Schlusszitat von Martin Niemöller bleibt eine prophetische Mahnung an die Verantwortung der Kirche in jeder Zeit.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Jude.
Als sie mich, holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Wer schweigt, wenn andere geholt werden, wird am Ende niemanden mehr haben, der für ihn spricht!
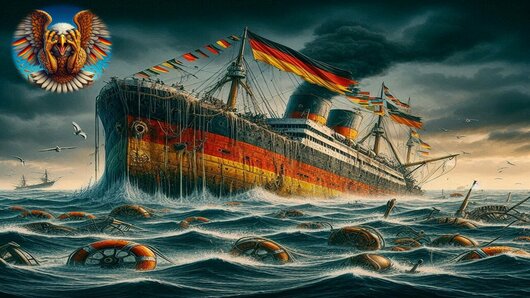
Vertrauensverlust in die deutsche Demokratie: Ursachen, Wandel und mögliche Wege
Eine Analyse die nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, dafür ist das Thema zu komplex.
Einleitung
Die deutsche Demokratie, einst gefeiert als Erfolgsmodell nach dem Zweiten Weltkrieg, erlebt seit geraumer Zeit einen massiven Vertrauensverlust. Breite Teile der Bevölkerung zweifeln an Politik, Parteien und Institutionen. Wie konnte es so weit kommen? Die folgende Ausarbeitung ist ein Versuch, nachzuzeichnen, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt und bürgernahe Solidarität nach 1945 erst zu Stabilität führten – und weshalb dieses Fundament heute ins Wanken geraten ist.
Wirtschaftswunder und Jahre des Zusammenhalts
Nach dem verheerenden Krieg gelang Deutschland ein beispiellos schneller Wiederaufbau. Die Gesellschaft rückte zusammen, Solidarität wurde nicht gepredigt, sondern gelebt und dem Willen, das zerstörte wieder aufzubauen.
Die Soziale Marktwirtschaft, die den Ausgleich von Leistungsprinzip und sozialer Sicherheit verband, stiftete Vertrauen und schuf eine breite Mittelschicht. Selbst in Zeiten wirtschaftlicher Krisen blieb der Glaube an das System erhalten – Unsicherheit blieb die Ausnahme.
Die sogenannten „Wirtschaftswunder“ Jahre
Zwischen 1950 und 1970 wuchs die Wirtschaft jährlich um bis zu 8 %, die Arbeitslosigkeit sank auf unter 1 %, der soziale Wohnungsbau schuf Millionen bezahlbarer Wohnungen, und die Gewerkschaften erreichten eine Stärke, die heute unvorstellbar ist.
1969-1982 wirtschaftliche und politische Herausforderungen und Krisen.
Die Demokratie wurde herausgefordert, doch sie hielt stand.
Die großen Herausforderungen.
Bundeskanzler Willy Brandt 1969–1974/ Helmut Schmidt 1974–1982
Ab 1970 Links-extremistischerTerror durch die RAF
Andreas Bader, Ulrike Meinhof und Gudrun Ennslin bildeten die erste Generation der RAF.
Die Ölkrise - 1973 - durch den Jom-Kippur-Krieg ausgelöst. Arabische Staaten wollten die westlichen Länder, gegen Israel, erpressen.
Das stoppte den Aufschwung, und die deutsche Wirtschaft rutscht 1974/75 in eine Rezession. Das Wachstum, das 1973 noch 4,7 Prozent beträgt, geht 1974 auf 0,2 und 1975 auf -1,4 Prozent zurück. Zwar erholt sich die Konjunktur rasch wieder – 1976 wächst die Wirtschaft um 5,6 Prozent – doch der Aufschwung gewinnt nicht mehr die Dynamik früherer Jahre.
Von solchen Zahlen wird heute nur noch geträumt
1980–2000
Und 1981/82, nach der zweiten Ölkrise, gehen die Wachstumsraten erneut in den Keller – auf 0 bzw. -1 Prozent. Die Preise steigen, die Zahl der Arbeitslosen auch.
Seitdem ist der Kampf gegen Massenarbeitslosigkeit die große sozialpolitische Herausforderung für alle Regierungen.
Und manchmal beginnt der Zerfall nicht mit einem Knall, sondern mit einem Flüstern.
Gesellschaftlicher Wertewandel ab den 1980er Jahren
Mitte der 1980er Jahre setzte ein schleichender Wertewandel ein: Individualismus und Egoismus gewannen an Bedeutung. Medien, Populärkultur und selbst Schlagermusik griffen solche Motive auf. Ein regelrechter Boom an Ratgeberliteratur und Seminaren propagierte die Selbstoptimierung
Diese Tendenzen spiegelten sich auch im Arbeitsleben wider: Berufliche Sicherheit und Solidarität traten gegenüber Flexibilität und Wettbewerb zurück. Selbst im Sport und in der Freizeit wurde der Einzelne, nicht mehr das Team, immer stärker in Szene gesetzt. Fitnessstudios und Individualsportarten ersetzten Vereinsleben und Gemeinschaft.
„Du bist der Architekt deines Glücks.“ – Egoismus wurde gesellschaftsfähig.
Was als Befreiung verkauft wurde, war in Wahrheit die Entkernung des Gemeinsinns.
International setzte sich die neoliberale Logik durch:
Deregulierung, Privatisierung, Flexibilisierung.
In Deutschland stiegen:
befristete Arbeitsverträge, schlechter bezahlte Leiharbeit, und Minijobs wurden für Arbeitgeber immer attraktiver.
Der Rückgang des sozialen Wohnungsbaus wird auf 75 % geschätzt.
Der Staat zog sich zurück, und der Bürger wurde zum „Unternehmer seiner selbst“.
3. Die Wiedervereinigung: Segen, Last und die erste große Vertrauensdelle
Die Wiedervereinigung war ein historisches Geschenk – und eine ökonomische Zumutung.
Die Kosten werden heute auf 1,5 bis 2 Billionen Euro geschätzt.
Doch das eigentliche Problem war nicht das Geld.
Es war die Erzählung: von blühenden Landschaften und
„Das zahlen wir aus der Portokasse.“ (Helmut Kohl)
Aussagen, die das Vertrauen zerstörten, weil er die Realität verhüllte.
Die Risse im Fundament wurden sichtbar.
4. Die Reformjahre: Mit Kanzler Schröders Agenda 2010.
Ging der Verlust der sozialen Sicherheit weiter.
Die 2000er Jahre brachten die tiefsten Einschnitte seit 1945:
Die Zahl der „Working Poor“ (Erwerbsarmut) stieg von 1,9 Mio. (2004) auf 4,1Mio (2024).
Prekäre Beschäftigung wurde Normalität
die SPD verlor über 20 Prozentpunkte an Vertrauen, von dem sie sich nicht mehr erholte
Die Demokratie wurde nicht abgeschafft –
aber sie wurde ausgedünnt.
Sie verlor ihre soziale Basis.
Was von der Wirtschaft und Industrie gefeiert wurde war für die Gesellschaft ein sozialer Schock.
5. Die Merkel-Ära: Stabilität an der Oberfläche, Erosion im Untergrund.
Angela Merkel regierte 16 Jahre lang – länger als jeder Kanzler der Bundesrepublik außer Kohl,
während Sie sich als Krisenkanzlerin inszenierte,
In: Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Pandemie.
Doch während die Welt Merkel als „Fels in der Brandung“ feierte,
veränderte sich im Inneren etwas Grundlegendes: Im Hintergrund gewann die radikale Marktwirtschaft stark an Einfluss.
Parteibindung sank von 80 % (1980) auf unter 30 % (2020)
Vertrauen in die Bundesregierung fiel nach 2015 auf 22 %
die politische Mitte erodierte, die Polarisierung nahm zu.
Deutschland wirkte stabil – doch es war ein Schlafwandeln.
6. Migration, Identität und der Verlust der kulturellen Selbstverständlichkeit
Seit 2015 kamen über 2,5 Millionen Schutzsuchende nach Deutschland.
Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund liegt heute bei 30 %.
Viele Menschen empfanden nicht die Migration selbst als Problem,
sondern die Art, wie sie politisch kommuniziert wurde:
„Wir schaffen das“: (Merkel) – Planlos, fehlende Kontrollen, überforderte Kommunen, kulturelle Spannungen.
Vertrauen schwindet nicht durch Zahlen,
sondern durch das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden.
7. Staatliche Leistungsunfähigkeit: Der Moment des Erwachens
Die Ahrtal-Katastrophe 2021 war ein Schock:
189 Tote, über 30 Milliarden Euro Schäden.
Behördenversagen auf allen Ebenen
Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sah die Bevölkerung:
Der Staat, dem man vertraut hatte, funktioniert nicht mehr zuverlässig.
Marode Infrastruktur, Gesundheitswesen destabilisiert, Polizei und Justizapparat ausgehöhlt.
Auch die Bundeswehr war ein Symbol des Verfalls:
jahrzehntelange Vernachlässigung, Unterfinanzierung, strukturelle Dysfunktion.
Ein Land, das einst für Effizienz stand,
war plötzlich nicht mehr handlungsfähig.
2021-2024 (Olaf Scholz) gab es die Ampelkoalition.
Ein letztes aufbäumen, das letzte Spiel im Koalitionspoker wurde gespielt.
Doch äußere und innere Krisen, zeigten schnell, das Spiel ist ausgereizt.
Ideologisches Gefeilsche und Gezerre, zeigten die Inkompetenz einer Regierung, in noch nie dagewesener Deutlichkeit.
Was dann nach dem Bruch 2024 zu Neuwahlen führte.
Die Regierungsbildung 2025 begann gleich mit einem Debakel für den nächsten Kanzler Friedrich Merz, der erst im zweiten Wahldurchgang gewählt wurde.
Die Koalition aus CDU, CSU und SPD, unterzeichnete dann den Koalitionsvertrag mit dem Titel; „Verantwortung für Deutschland“.
Wer Augen hat, der sehe, wer Ohren hat der höre.
Die Politik zeigt sich weiter Hilf - und Perspektivlos, vergibt ihre Arbeit an Kommissionen, Beratergremien und
Lobbyisten, und verlagert so das politische Handeln, ins Nirwana.
Während die Verschuldung steigt und tiefgreifende Reformen ausbleiben.
Nimmt der Staatsbankrott durch Hyperverschuldung Form an.
8. Religion, Kultur und der Verlust der seelischen Mitte
Die Kirchen verlieren seit 1990:
katholisch: –30 %, evangelisch: –40 %
Einen historischen Rekord gab es im Jahr 2022, als allein 522.000 Menschen aus der katholischen Kirche austraten.
demgegenüber traten über 380 000 Menschen aus der evangelischen Kirche aus.
Dazu Aussagen wie von Helmut Kohl in 1980er, sinngemäß, häufiger wiederholt: „Deutsch sein ist nicht mehr zeitgemäß – modern ist europäisch.“
Die Bundesrepublik wurde „postnational“ – ohne es je so zu nennen.
Die Reaktionen darauf: Man fühlte sich „entkernt“, als würde die nationale Identität politisch entwertet.
Und die Körpersprache von Angela Merkel nach ihrem Wahlsieg 2013, riss sie ihrem Parteikollegen Hermann Gröhe, die Deutschlandfahne aus der Hand und ließ sie beiseiteschaffen.
Gleichzeitig wächst die religiöse Vielfalt,
und viele erleben dies nicht als Bereicherung, sondern als Bedrohung, durch Anbiederung an den Islam, Verlust der eigenen kulturellen-religiösen Selbstverständlichkeit.
Eine Gesellschaft ohne eigene gemeinsame Rituale und Symbole
wird anfällig für Angst, Misstrauen und Fragmentierung.
Dazu kommt das Gefühl, dass Kritik delegitimiert wird.
9. Der Kipppunkt: Demokratie im Modus der Erschöpfung
Heute vertrauen: nur 25 % dem Bundestag, nur 20 % der Bundesregierung, weniger als 15 % den Parteien
Das ist kein Betriebsunfall. Das ist ein Systemsignal.
Neuestes Beispiel Berlin, Januar 2026, der linksextremistische Terror, zeigt wieder seine hässliche Fratze.
Und das Gespenst der Anomie = Chaos, Normenverfall, Gesetzlosigkeit steigt auf
Gedanke / These
Berlin ist noch nicht überall. Aber was wir dort sehen, ist kein isolierter Ausbruch, sondern ein Symptom einer tieferliegenden Erosion: des Vertrauens, der gemeinsamen Normen, der gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit. Anomie zeigt sich zuerst an den Rändern – doch sie kündigt an, was die Mitte bedroht, wenn Orientierung, Zusammenhalt und Verantwortung brüchig werden.
Demokratie stirbt nicht durch einen Putsch.
Sie stirbt an Ermüdung, Erschöpfung, und durch Überforderung.
Durch Verlust der gemeinsamen Erzählung.
10. Epilog: Was bleibt?
Bis auf Deutschlands- Anfangsjahre, hat es niemand wirklich begriffen, weder Kirchen noch Politik, Deutschland ist und war, noch in den Pandemiezeiten, trotz Unzulänglichkeiten und Ungereimtheiten, gut sichtbar.
ein begnadetes Land.
Wir haben Wohlstand genossen –
und Verantwortung verlernt.
Wir haben Freiheit gefeiert –
und Bindung verloren.
Wir haben Vielfalt begrüßt –
und Orientierung aufgegeben.
Der Kipppunkt scheint erreicht.
Vielleicht ist es der Beginn einer neuen Epoche.
Vielleicht ist es die Stunde derer,
die nicht schreien, nicht zerstören, sondern bewahren, nicht resignieren, sondern zeugen, die Hoffnung nicht aufgeben, sondern beten.
Denn, es geht ohne Gott in die Dunkelheit.
Und jede Erneuerung beginnt mit einem Überrest.
Und jeder Überrest beginnt mit einem Menschen,
der sagt:
„Ich habe hingesehen.“
Und doch gilt ein Merksatz:
In einer Demokratie, muss immer wieder gewählt werden.
in einer Diktatur nur
EINMAL!
Der Weltverfolgungsindex 2026 zeigt einen neuen Höchststand der weltweiten Christenverfolgung. In vielen Ländern verschärfen sich staatliche Kontrollen, islamistische Gewalt und gesellschaftlicher Druck. Besonders betroffen sind Regionen in Afrika südlich der Sahara, im Nahen Osten und in Teilen Asiens. Die folgende Tabelle zeigt die 20 Länder, in denen Christen derzeit am stärksten verfolgt werden.
Weltweit über 380 Millionen Christen stark verfolgt und diskriminiert
1 | Nordkorea | 97, 2 | Somalia | 94, 3 | Jemen | 93, 4 | Sudan | 92.
5 | Eritrea | 90, 6 | Syrien | 90. 7 | Nigeria | 89, 8 | Pakistan | 87,
9 | Libyen | 87, 10 | Iran | 87, 11 | Afghanistan | 86. 12 | Indien | 84.
13 | Saudi-Arabien | 82, 14 | Myanmar | 81, 15 | Mali | 81.
16 | Burkina Faso | 80, 17 | China | 79. 18 | Irak | 79.
19 | Malediven | 79, 20 Algerien 77
Die Christenverfolgung ist ein hartes, ungeliebtes Thema und passt so gar nicht ins Bild der Leichtigkeit, in dem das Evangelium gerne gesehen wird.
Dank Open Doors wird es immer wieder zur Christusnachfolge dazugehörig ins Gedächtnis gerufen.
Noch sind wir in Deutschland nur indirekt betroffen, doch wer offenen Auges auf unser Land blickt, sieht schon Anzeichen.
Aus Politik, Medien und Teilen der Kirchen.
Das berührt einen tief – und genau an dieser Stelle wird aus einer Statistik plötzlich Evangelium, Schmerz und Trost zugleich.
Jesus sagt in Johannes 16,2:
„Es kommt die Stunde, in der jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun.“
Das ist einer der härtesten Sätze Jesu. Und zugleich einer der ehrlichsten. Er nimmt die Verfolgten ernst, indem er nichts beschönigt. Aber er tut noch mehr: Er ordnet das Geschehen geistlich ein.
1. Jesus überrascht nicht – er bereitet vor
Er sagt nicht: „Vielleicht passiert euch das.“
Er sagt: Es wird kommen.
Damit nimmt er seinen Jüngern die Illusion der Leichtigkeit, aber nicht die Hoffnung.
Er sagt: Ich weiß, was euch erwartet – und ich gehe vor euch.
2. Verfolgung geschieht oft im Namen Gottes
Das ist das Erschütternde:
Die Täter glauben, sie tun etwas Heiliges.
Das gilt für:
religiösen Fanatismus,
staatliche Ideologien,
politische Reinheitsvorstellungen,
kulturellen Druck.
Jesus benennt das, damit seine Jünger nicht denken:
„Wir haben versagt.“
Sondern:
„Wir stehen in seiner Geschichte.“
3. Verfolgung ist kein Zeichen von Gottesferne – sondern von Christusnähe
In Johannes 15 sagt Jesus unmittelbar vorher:
„Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen.“
Das ist keine Drohung.
Es ist eine Zugehörigkeitserklärung.
Die Verfolgten sind nicht vergessen.
Sie sind Christus besonders nah.
Derselbe Jesus, der gesagt hat: „Sie werden euch verfolgen“, hat auch gesagt:
„Euer Herz erschrecke nicht.“
„Ich habe die Welt überwunden.“
Das ist die Perspektive von unten, aus der Welt der Jünger.
4. Die Offenbarung zeigt, wie Gott es sieht
Offenbarung 6,9–11 ist die Perspektive von oben, aus Gottes Thronsaal.
Die Märtyrer sind nicht vergessen.
Sie sind nicht stumm.
Sie sind nicht verloren.
Sie sind gesehen, gehört, bekleidet, geehrt.
5. Die Frage „Wie lange noch?“ ist kein Zweifel — sondern Glaube
Sie fragen nicht:
„Gibt es Gott?“
Sondern:
„Wann greifst du ein?“
Das ist die Sprache der Psalmen, der Propheten, der Leidenden aller Zeiten.
6. Die Antwort Gottes ist keine Vertröstung
„Noch eine kleine Zeit“ bedeutet:
Gott hat die Geschichte nicht aus der Hand verloren
Das Leid ist begrenzt
Die Vollendung kommt
Die Gerechtigkeit bleibt nicht aus.
Amen

Fürbitte Gebet für verfolgte Christinnen und Christen weltweit
Gott, Schöpfer von Himmel und Erde,
Heute bringen wir vor dich all jene Menschen, die wegen ihres Glaubens bedroht, verfolgt, zum Schweigen gebracht oder sogar dem Tod ausgesetzt sind. Stärke ihr Herz, damit sie in Zeiten von Angst und Unsicherheit nicht allein sind. Schenke ihnen schützende Begleiter und öffne Wege, die in die Freiheit führen.
Gib ihnen Glaubensstärke und Kraft, dass sie fest und treu wie Daniel sein können.
Und ihr Glaubenszeugnis auch diejenigen erreicht, die ihnen Schmerzen zufügen.
Wir denken an Familien, die auseinandergerissen wurden, an Gemeinden, die im Verborgenen ihren Glauben leben, und an alle, die Gewalt, Gefangenschaft oder Ausgrenzung ertragen müssen. Umhülle sie mit deinem Frieden, der größer ist als Hass und Furcht.
Wir bitten auch für die Verantwortlichen in Politik, Gesellschaft und Kirchen: Öffne ihre Augen für das Leid und bewege ihre Herzen, damit sie sich für Gerechtigkeit einsetzen und die Würde jedes Menschen achten.
Du bist der Gott, der Wege bahnt, wo wir keine erkennen. Lass dein Licht die Welt erhellen, damit Hoffnung wächst, Mut zurückkehrt und deine Liebe jede Verfolgung überstrahlt.
Amen.

Der Fall Mike Lynch
Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. In Anlehnung an Lukas 12,20
Mike Lynch wurde im spektakulären Betrugsprozess der neueren Wirtschafts-Geschichte, freigesprochen.
Doch das letzte Wort, hatte nicht die irdische Gerichtsbarkeit.
Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde die sind nicht zu erklären!
Mike Lynch, kam aus einfachen Verhältnissen. durch Fleiß und vom Schicksal begünstigt, brachte er es in Wirtschaft und Politik zu höchster Anerkennung und stieg bis in die Machtzentren der Politik auf.
Mike Lynch gründete 1991 das
Softwareunternehmen Cambridge Neurodynamics.
Daraus entstand die von ihm mitgegründete Autonomy Corporation, und weitere Firmen-Mitbegründungen..
Medien feierten ihn dann als den „britischen Bill Gates“.
Im Oktober 2011 verkaufte er das Unternehmen Autonomy Corporation, für elf Milliarden US-Dollar an Hewlett Packard
Anschließend verlor das Unternehmen Hewlett Packard rapide an Wert.
Dieses Übernahme-Debakel führte zu Betrugsvorwürfen gegen Mike Lynch.
Der Vorwurf, das elf-Milliarden Geschäft manipuliert zu haben.
Er wurde dann in Großbritannien in einem Zivilprozess schuldig gesprochen, jedoch nicht Strafrechtlich verurteilt.
Anschließend wurde er dann wegen demselben Betrugsverdacht an die USA ausgeliefert.
Lynch wehrte sich vehement gegen die Auslieferung, denn ein Freispruch schien unwahrscheinlich.
Die Entscheidung zur Auslieferung war besonders bemerkenswert, da Lynch in Großbritannien bereits zivilrechtlich belangt wurde.
Die US-Behörden dennoch auf eine separate Anklage drängten.
Dies führte zu einer intensiven juristischen Auseinandersetzung, die schließlich in der Genehmigung der Auslieferung gipfelte.
Wo Lynch in Hausarrest kam. Dem 59-Jährigen, drohten bis zu 25 Jahre Gefängnis.
Eine Führungskraft von Autonomy, Sushovan Hussain, ein Bauernopfer? wurde 2018 wegen Betrugs zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.
Im März 2024 stand Lynch, von einem Staranwaltsteam vertreten, in San Francisco vor Gericht, wurde überraschender Weise im Juni 2024 von der Jury in allen Punkten für nicht schuldig befunden
Mike Lynchs gerichtliche Auseinandersetzungen dauerten dramatische 12 Jahre.
Und endeten mit einem dreimonatigen Strafprozess in San Francisco.
Nach nur zwei Verhandlungstagen befanden die Geschworenen Lynch und sein Geschäftspartner Chamberlain in allen Anklagepunkten für nicht schuldig.
Stephen Chamberlain, kehrte nach Großbritannien zurück. Er wurde am 17. August 2024 in Cambridgeshire, beim Joggen, von einem Auto erfasst, und verstarb drei Tage später im Krankenhaus.
Die Polizei hat keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gefunden und betrachtet den Vorfall als tragischen Unfall.
Sein Tod ereignete sich nur wenige Tage vor dem Untergang der Yacht von Mike Lynch vor Sizilien.
Mike Lynch wurde ab dem 19. August 2024 vermisst. Die Segelyacht der Familie, mit dem Namen "Bayesian." erinnerte Mike Lynch an den Ursprung seines Reichtums
Die Bayesian, sank etwa eine halbe Seemeile vor der Küste Siziliens, während plötzlich ein Unwetter aufkam.
Er hatte auf der Kreuzfahrt seinen Erfolg im Betrugsprozess mit Menschen, die ihm dabei geholfen hatten, sowie deren Familien gefeiert.
22 Menschen befanden sich an Bord, davon ertranken sieben Personen, fünfzehn Personen konnten gerettet werden.
Aber dass gerade diese eine Yacht, von einem Wetterphänomen, einem Wassertornado erfasst wurde und unterging, während bei den anderen Schiffen rundherum nichts passierte, ist schon seltsam.
Und die Yacht sank innerhalb weniger Minuten.
Obwohl die Yacht, wie die Titanic, als unsinkbar galt.
Zu den Opfern zählen neben Lynch dessen achtzehnjährige Tochter Hannah, der Koch der Yacht, der Bankier Jonathan Bloomer und dessen Ehefrau Judy, der Rechtsanwalt Chris Morvillo, der an Lynchs Freispruch in San Fransisco mitarbeitete, und dessen Ehefrau Neda. .
Die Ehefrau von Mike Lynch, Angela Bacares, überlebte.
Die ältere Tochter, Esme Lynch, war nicht an Bord.
Schon seltsam, dass gerade die Geldelite schlagartig auf dem Grund des Meeres liegt, kurz nachdem das Korruptionsverfahren gegen das Weltunternehmen HP gewonnen wurde. Titelten einige Medien.
Jahrelang behauptete Lynch, als Sündenbock für eine misslungene Übernahme verantwortlich gemacht worden zu sein. Jetzt galt der Brite als „rehabilitiert“.
„Die Wahrheit hat endlich gesiegt“, sagte sein Anwalt Charles Morvillo.
Nur wenige Monate nach diesem Triumph vor Gericht sind Lynch, Chamberlain und auch Morvillo tot.
Was auch immer noch zu tage treten mag, das hier ist mysteriös.
Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der HERR,
und nicht auch ein Gott, der ferne ist?
Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe?.
Jeremia 23,23+24 a
Denn ich kenne eure Frevel, die so viel sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt; denn es ist eine böse Zeit.
„Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten.
Denn was der Mensch sät, das wird er ernten.“
Galater 6,7
Gott setzt ab und an Ausrufezeichen, leider werden sie wenig beachtet.
Doch manchem Spötter kostet der Spott das Leben.
Die Bibel ist kein Märchenbuch, sie ist unteranderem ein Nachschlagewerk, um Beispiele aufzuzeigen, dass es für Arroganz, Selbstüberhebung, und Selbstgerechtigkeit Konsequenzen geben kann.
Und das letzte Wort, nicht die irdische Gerichtsbarkeit hat.

